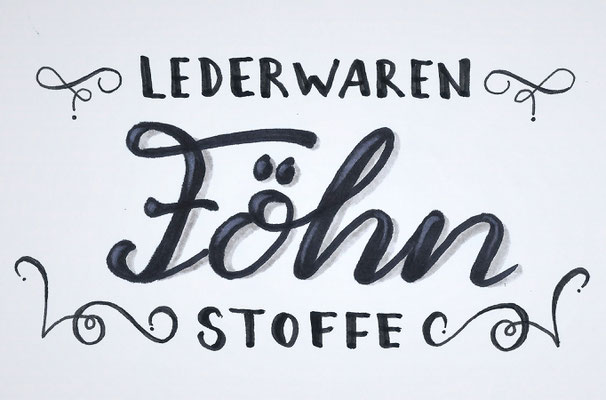Verschiedene Beschreibungen des Schwyzer Narrentanzes
Wo immer es auch um Schwyz und seine Fasnacht geht, wird schon bald einmal der Schwyzer Narrentanz genannt und seine Eigenart erwähnt.
Der ein bedeutender Schweizerdichter und Schwyzkenner Meinrad Ingling erwähnte ihn in seinen Büchern oft.
Im Folgenden einige Zitate aus Büchern, welche den Narrentanz charakterisieren und auf seine weit zurückliegende Herkunft hinweisen.
Meinrad Inglin erklärt in seinem Aufsatz "Das Jahr des Volkes" was der Narrentanz ist:
Vor den Wirtschaften führt die Rott in einem dichten Zuschauerkreis einen uralten Tanz auf. Was dazu getrommelt wird, ist eine geregelte Folge immer wiederkehrender Takte, die sich dennoch kaum einer der bekannten Taktarten genau fügen will, eine merkwürdige, von Wirbeln durch-setzte, aufreizende Tanzrhythmik. So verhält es sich auch mit dem Tanze selber, der aus knappen, sprungartigen, doch keineswegs willkürlichen Bewegungen besteht und zur richtigen Ausführung bedeutende Kraft, Gelenkigkeit und Ausdauer erfordert. Er gleicht den kultischen Tänzen wilder Völker, sein Ursprung ist wohl im germanischen Heidentum zu suchen.
Meinrad Inglin: Notizen des Jägers, Atlantis Verlag AG, Zürich 1973, Seite 30
Das Thema des Narrentanzes kommt im "Werner Amberg" von Meinrad Inglin mehrmals vor, ja es durchzieht das Buch fast leitmotivartig. Inglin charakterisiert den urwüchsigen Tanz treffend:
Gegen Abend aber zog ich mit einer Rotte herum und tanzte zweimal vor Gasthäusern zu jenen erregenden Wirbeln und Schlägen der Trommeln, die durch viele Leidens- und Freudenstage meiner Kinder- und Knabenjahre geklungen hatten, den uralten Narrentanz.
Dieser ursprünglich heidnische Tanz mochte, wie so vieles aus demselben Bereich, vom sieghaften christlichen Geiste früh um seinen tieferen Sinn gebracht und ins Närrische umgedeutet worden sein, doch hatte er seine Form bewahrt und glich darin den echten kultischen Tänzen, die man noch kannte. Seine wenigen, immer wiederkehrenden Bewegungen waren genau geregelt und schienen ohne viel eigene Mühe des Tanzenden nur dem
inneren Antrieb zu folgen. Auf die Dauer jedoch erforderte er eine bedeutende Anstrengung, er wurde mit häufigen Unterbrüchen getanzt und konnte nur um den Preis der Erschöpfung von spannkräftigen, durch den Trommelrhythmus völlig erfassten Tänzern in einer Art von Besessenheit länger als drei Minuten ausgeführt werden. ich tanzte ihn jetzt ohne Absicht, hingerissen vom Rhythmus, wie besessen und fühlte mich dabei so frei von allen Qualen, so einig mit mir selber wie nur in meinen unbeschwertesten Stunden.
Meinrad Inglin: Wermer Amberg, Atlantis Verlag AG Zürich 1949, Seite 226
Im Roman "Die Welt in Ingoldau" beschreibt Inglin die Situation vor einem Restaurant:
Die Trommler stellten sich neben den Eingang, schwitzend, den Hut zurückgeschoben, eine brennende Brissago im Mund, und rührten die Schlägel kräftiger. Die Rotte aber tanzte nun, was die Trommler schlugen, eine geregelte Folge aufreizender Rhythmen, einen uralten heidnischen Tanz, der, nur den kultischen Tänzen wilder Völker vergleichbar, hier als ein Vermächtnis des dämonengläubigen eingeborenen Stammes zum Befremden aller bloss Vernünftigen noch immer wirksam war.
Meinrad Inglin: Die Welt in Ingoldau, Atlantis Verlag AG Zürich 1964, Seite 318
Über die Herkunft des Narrentanzes äussert sich Martin Gyr in seinem Buch "Schwyzer Volkstum"
Der Nüssler tanzt auf Trommelschlag in der Einheit. Nach unserer Ansicht stammt der Nüsslertanz aus der Zeit der helvetisch- römischen Kontakte, wo das Tanzen heidnische Kulthandlung war. Wenn man fragt, wer ihn überliefert habe, kann man auf schwyzerische Söldner schliessen, die sich 1099 und 1155 an Feldzügen nach Italien und ins Heilige Land beteiligt hatten. Bildlich gedeutet ist der frauenlose Tanz Sprengen der Nussschale und Freilegen des Kernes. Er fordert die Dressur der Fuss- und Kniegelenke.
Martin Gyr: Schwyzer Volkstum, Meinrad Verlag Einsiedeln 1955
Im Buch "Fasnachtsspiele" von Oskar Eberle wird im Abschnitt Tänze im Spiel eine interessante Jahrzahl genannt. Er sagt, dass in allen alten Spielen getanzt wurde. 1860 und 1865 kam mit Bestimmtheit der Narrentanz vor.
Die Schwyzer Zeitung vom 23. Februar 1968 wusste zu berichten, dass der Name "Nüsseln" vom vormaligen Auswerfen von Nüssen abstammen müsse. Das Nüsseln brauche Konzentration, Taktgefühl, Ausdauer (Konzentration) und Balancevermögen. Der Narrentanz sei schon um 1400 gespielt worden. Ob diese Zahl belegt werden kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Weiter schreibt die Zeitung, dass der Narrentanz eine Polka-Taktart sei, was bis zu einem gewissen Grade stimmt, denn eine reine Polka Taktart ist es nicht, die Andersartigkeit und zugleiche Verwandtschaft macht gerade die Eigenart aus.
Jetzt will ich einen fachkundigen Schwyzer zu Worte kommen lassen. Paul Kamer schilderten Narrentanz auf der Platte "Schwyzer Nüssler" folgendermassen
... und wenns i dä Rott zämä sind ihrer 30 oder 40 und meh, dä tanzids der uralt bätschig Narrätanz, dr Nüssler. Nüsslä heisst das vielleicht wills früener statt denä türä Schellägürt hohl Nüss umäbundä gha hend, oder wills Nüss und Öpfel usgrüert wordä sind.
Dr Narrätanz oder znüsslä, das chönd bloss Burschtä und Mannä, hützutags au öppä Maitli mit liechtä, chreftigä Beinä. Da mues einä uf eim Fläck zringsel um si sälber umä und uf dä Zechäspitz gümpelä, schön im Takt vo dä Trummeler, nie mit dä Färsenä s'Bodä cho, d'Füess gnau nach de Reglä usäspickä und erseht nu dä Buggel grad ha derzu. Zwe Trummeler schlönd dä Tanztakt, ä mordsmässig schönä Schtreich, mit wildä Synkopä, stundälang vo Gass zu Gass, bis äs inachtet.
Schallplatte "Schwyzer Nüssler", Tonica TO-V-17060
Wirklich treffend ist Paul Kamer die Schilderung gelungen. Das Wesentliche hat er erwähnt und Typisches des Tanzes aufgezeigt, dies im lebendigen Schwyzer Dialekt.
Der Schwyzer Lokalhistoriker Josef Kessler schrieb in der Jubiläumsschrift "50 Jahre Schwyzer Nüssler" einen aufschlussreichen Artikel, der über die Anfänge zu berichten weiss:
"Frägt man die Schwyzer, wie alt der Brauch des Narrentanzes sei, erhält man achselzuckenden Bescheid, dass der Fasnachtsbrauch wohl aus heidnischer (vorchristlicher) Zeit stamme. Sicheres weiss niemand, da keine schriftlichen Aufzeichnungen (Urkunden oder Chroniken) diesen seltsamen Fasnachts oder Wintersonnenwendebrauch erwähnen oder gar schildern. Alle Konstruktionen sind irgendwie hypothetisch. Sie fassen zum Teil auf mündlichen Überlieferungen, mehrheitlich jedoch auf Vergleichen des Brauchtums im ganzen Alpenraum. Vielfältig traten an die Urbewohner unserer Gegenden die Unbilden der Witterung speziell zur Winterszeit heran. Dies veranlasste diese heidnischen Stämme zu allerhand kultischen Handlungen, einerseits um die Götter (vorab Wodan, Donar oder Thor, Froh und seine Gattin Freya) zu besänftigen und anderseits zu Abwehrmassregeln, um die bösen Geister, die Dämonen, Hexen und Unholde zu bannen. Durch Feuer, Tänze,
Musik, Trommelschlag, Gesänge und Zauber erhofften diese Urvölker von den Göttern Schutz und zugleich Abwendung allen Unglückes. Sie glaubten damit auch Fruchtbarkeit, Gesundheit und Gedeihen für Mensch und Tier, für Wunn und Weid, für Feld und Wald herabzuzaubern.
Viele dieser heidnischen Kultbräuche, weil Aberglauben sind seit der Christianisierung durch den vehementen Widerstand des Klerus und der Behörden ganz verschwunden oder doch stark umgestaltet und nach christlichem Sinne umgedeutet worden.
Seit der Führung von Ratsprotokollen ist in denselben wiederholt von harten Verboten gegen das "Maskengehen und Trommeln" am Abend nach der Betglocke, gegen das "Greiffeln" die Rede".
" 50 Jahre Schwyzer Nüssler" Triner Druck Schwyz 1971
Die Beinstellung
Der Strich bedeutet die Unterlage, auf der genüsselt wird. Zur Orientierung sind die Taktstriche eingezeichnet.
Wichtig ist, dass wir hier den Nüssler von hinten sehen, also ist das rechte Bein in der Zeichnung in Wirklichkeit das rechte und dasselbe gilt für das linke Bein.
Für die Erklärung scheint mir die Erklärung auf dem Original von Tambour Toni Kälin am besten geeignet:
«Der Nüssler dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Es ist darauf zu achten, dass genau mit dem Schlag auf die Trommel auch der betreffende Fuss spickt. Angefangen wird aus der Ruhnstellung. Das Nüsseln darf nur auf den Fussspitzen federnd, ohne jede Verkrampfung, ausgeführt werden. Bei dieser Beinstellung sind beide Absätze nach hinten hoch zu spicken. Bei dieser kommt der linke Fuss einen Moment auf den Boden und der Rechte spickt nach vorn seitwärts und so umgekehrt. So sind beide Füsse einen Moment auf dem Boden.»
Diese Aufstellung wurde an der Fasnacht 1959 für die Gesellschaft zur Hebung alter Fasnachtssitten und Gebräuche (heute Schwyzer Nüssler) gemacht und gilt als Richtlinie für das Preisnüsslen. Auch soll damit die Erhaltung des schönen Brauches gesichert sein.
Noch eine Ergänzung zu den Ausführungen von Toni Kälin.
"Schwyzer Narrentanz" Originalnotation von Toni Kälin senior, Chlösterliboden, Schwyz
Der Nüssler dreht sich gegen den Urzeigersinn und beginnt dann mit dem rechten Fuss aus der Ruhnstellung, wenn er im Uhrzeigersinn nüsselt, so beginnt er mit dem linken Fuss.
Das Original von Toni Kälin, Chlösterliboden war mehr eine Skizze, als ein Aushängeexemplar. Bernhard Annen (Bärädi) gestaltete ein kunstvoll verfertigtes Blatt mit dem Titel "Schwyzer Narrentanz". Dies nach der Vorlage von Toni Kälin. Der Text wurde gekürzt, aber nur so viel, dass die wichtigsten Anweisungen alle noch auf dem Blatt zu finden sind. Damit ist der Narrentanz 1959 das erste Mal schriftlich aufgezeichnet worden und gilt so als Richtlinie für die heutige und kommende Zeit.
Das korrekte Nüsseln
Der Narrentanz besteht grundsätzlich aus drei Teilen, dem Spicken mit dem rechten Bein, dem Spicken mit dem linken Bein und dem Sprung in die Höhe. Dann beginnt der Tanz wieder von vorne. Der Nüssler dreht sich dabei um die eigene Achse, meist im Gegenuhrzeigersinn. Auf den Zehenspitzen kommt das erste rechte Spicken nach vorne seitwärts, und währenddem das rechte Bein wieder zurückkommt, spickt schon das linke Bein nach vorne, dies war also nur einen kurzen Moment auf dem Boden. Jetzt berührt das rechte Bein kurz den Boden und sobald das linke Bein vom Spicken zurückkommt, geschieht der Sprung, wobei beide Absätze nach hinten hoch spicken. Nach dem Sprung landet zuerst das linke Bein und das rechte folgt mit einem sehr raschen Nachstellschritt und schon beginnt wider das rechte Spicken. Dies mag vielleicht leicht tönen, doch die Ausführung muss gelernt sein. Der Narrentanz ist eine Polkataktart, aber der Takt ist eben nicht regelmässig, er ist zwischendurch "ruckartig verhakt" und dabei auf den Trommelschlag genau übereinzustimmen, erweist sich schon als kleine Kunst. Mit dem Erlernen des Nüsslens sollte möglichst früh begonnen werden. Weshalb heutzutage alljährlich in den Primarschulen daran geübt wird und Kindernüsslerkurse durchgeführt werden.
Für das präzise Nüsseln beachten die Preisrichter an einem Preisnüsseln folgende wichtige Punkte:
a) Richtig beginnt der Nüssler: Im Uhrzeigersinn - links, im Gegenuhrzeigersinn - rechts. D.h. mit dem rechten
Bein beginnen, mit der rechten Achsel vorwärts und umgekehrt.
b) Beim Anschritt das eine Bein leicht anziehen und mit dem andern zum erstenmal ausspicken.
c) Der Tanz muss im Trommel-Takt ausgeführt und aus normaler Ruhnstellung begonnen werden.
d) Verkrampfung des Körpers soll vermieden werden. Der Tanz soll gefedert und fliessend ausgeführt werden.
e) Absatznüsslen ist nicht gestattet. Vom ersten Spicken an dürfen die Absätze den Boden nicht mehr berühren.
f) Ein eventueller Stock oder Schirm darf nicht als Stütze gebraucht werden.
g) Mit dem Oberkörper darf nicht "angegeben" werden. Der ganze Maschgrad hat eine senkrechte Haltung mit "Kopf hoch" beizubehalten.
h) Das sogenannte "tief" oder "hoch" Nüsslen veranlasst nicht zu Punktabzug.
i) Der musikalisch nicht erfassbare Trommel-Ton muss durch ein Beinspicken taktsicher erwidert werden.
k) Bei Tambour's Neunerruf wird verlangt, dass beide Absätze leicht nach Hinten in die Höhe gespickt werden.
1) Im sogenannten "Schlepp"-Teil ist unbedingt auf die
Takt-Richtigkeit zu achten. Das betreffende Bein
(nicht Anfangsbein) muss taktrichtig gespickt werden.
Reglement für das Preisnüsslen, Schwyzer Nüssler, 13. Januar 1973, Seite 2
Wenn alle diese Punkte beachtet werden, darf sich einer sicher rühmen, den Narrentanz zu beherrschen. Für das Nüsseln brauch es einige Komponenten: Taktgefühl, Gelenkigkeit, Kraft, Ausdauer, Konzentration, Balance, Spritzigkeit und Schnauf.
Zu ihrem Jubiläum haben die "Schwyzer Nüssler" eine Schallplatte herausgegeben, auf der ersten Seite erzählt Paul Kamer von den Schwyzer Nüsslern und ihrer Fasnacht. Auf der zweiten Seite trommeln Vater und Sohn Toni Kälin, Chlösterliboden den Schwyzer Narrentanz.

Die Herkunft des Narrentanzes und seines Namens
Vorerst ist die Feststellung zu machen, dass einschlägige Dokumente oder Abhandlungen über die Herkunft gar nicht vorhanden sind. Weder von privaten Forschern noch von den Behörden war früher nicht viel zu vernehmen. So sind auch in Ratsprotokollen keine Angaben zu finden, denn die Behörden standen der Fasnacht alles andere als freundlich gesinnt gegenüber. Höchstens Verbote für das Maskentreiben lassen sich eruieren.
Es sind allerdings doch einige Äußerungen zu finden, die von verschiedenen Seiten geteilt werden. So gehen sich alle einig, dass früher der Tanz eine kultische Handlung darstellte. Ein Kulttanz wilder Völker oder ein Tanz aus dem germanischen Heidentum also ist er wahrscheinlich ein heidnischer Tanz. Durch den sieghaften, christlichen Geist soll er um seinen Sinn gekommen und ins Närrische umgedeutet worden sein.
Sicher ist, dass der Narrentanz im heutigen Sinn voll und ganz dem Narrenhaften, dem fasnächtlichen Geist entspricht. Es wird angenommen, dass sich der Dämonen und Fruchtbarkeitstanz im Laufe der Zeit zu einem Narrentanz entwickelt hat. Die Form wurde aber bewahrt, wenn auch der Sinn geändert hat. Martin Gyr gibt eine Erklärung wie der Narrentanz in unsere Lande gekommen sein könnte. Der Tanz solle aus der Zeit der helvetisch-römischen Kontakte kommen, wo das Tanzen heidnische Kulthandlung war. Schweizer Söldner, welche an den Feldzügen um 1000- 1200 nach Italien und ins Heilige Land teilnahmen, sollen ihn überliefert haben. Somit könnte die Jahrzahl 1400 aus der Schwyzer Zeitung über das erstmalige Auftauchen gerechtfertigt sein. Sicher ist das Auftreten des Narrentanzes im Japanesenspiel 1860 dokumentarisch zu beweisen. Der Narrentanz wurde auch in unsere Zeit hinein überliefert. Sowohl die Trommelrhythmen wie auch die Bewegungen des Tänzers sind überliefert worden. Die Überlieferung erfolgte von Ohr zu Ohr und von Aug zu Aug. Nie dachte man daran, etwas zu notieren, vielmehr lebte man den Tanz zu gegebener Zeit. Heute ist man allgemein der Ansicht, dass sich der Tanz über eine sehr lange Zeit (ein paar Jahrhunderte) nicht verändert hat.
Narrentanz wird der Tanz wohl erst genannt worden sein, als er schon umgedeutet war auf das Närrische. Jener, welcher den Tanz ausführt, ist ein sogenannter Nüssler, der den Tanz nüsselt. Dieses Wort kann aus zwei möglichen Gründen entstanden sein. Einmal, weil die Maskeraden früher keine Schellengürte getragen haben, sondern Gürte, die mit hohlen Nüssen bestückt waren, zum andern, weil früher statt der Orangen Äpfel und Nüsse ausgeworfen wurden. Auch hier kann man sich nicht eindeutig festlegen.
Der Schwyzer Narrentanz hat zurecht das Vorwort "Schwyzer",
denn nirgendswo als in der Gemeinde Schwyz wird er gleich getrommelt und getanzt. Schon in den einzelnen Filialen sind minime Unterschiede festzustellen.
Auf "unseren" Narrentanz sind wir begreiflicherweise sehr stolz.
Wie wird er getrommelt und getanzt (seine Eigenheiten)
Lange Zeit war keine Notation des Narrentanzes vorhanden. Er wurde immer wieder von Generation zu Generation weitergegeben.
Dem versierten, langjährigen Tambour Anton Kälin Senior fiel es ein, diesen Tanz aufzunotieren.
Im Jahre 1959 verfertigte er diese Notation und schrieb dazu auch die Trommelsprache, ebenso zeichnete er die Beinstellung des Tänzers. Freilich wäre es einem "Nichtkenner" nur schwerlich möglich, den Narrentanz nach diesen Unterlagen zu erlernen. Meistens wird er ja durch Abschauen und Nachahmen vermittelt. Die folgenden Ausführungen sind gestützt auf das Original von Toni Kälin und seine abgegebenen Erklärungen.
Die Trommelsprache
Durch sie kann der Narrentanz wörtlich festgehalten
werden. Die einzelnen Wortgruppen folgen einander rasch.
Zeile (Takt 1-4): rreng rreng / tengrreng tle / rreng rreng / tengrreng
Diese Zeile wird wiederholt und führt dann zur zweiten Zeile.
Zeile (Takt 5-8): rrrreng / tengrreng tle / rrrreng / tengrreng
Auch diese Zeile wird wiederholt, wobei im Anschluss daran wieder die erste Zeile folgt.
Die Trommelnoten
Für die Trommelnotation ist nur eine Notenlinie nötig. Was über der Linie geschrieben wird sind Schläge mit der rechten Hand, was unter der Linie notiert ist, Schläge mit der linken Hand.
Ich will nach dem Original die einzelnen Klanggebilde benennen.
(Die Nummern in Klammern sind in der Zeichnung über den betreffenden Noten.)
1. Takt: - rechts eingeschlagener Fünferruf ohne Schlepeinschlag mit betontem, kräftigem Abschlag (1)
- nochmals rechts eingeschlagener Fünferruf ohne Schlep einschlag mit betontem, kräftigem Abschlag (2)
2. Takt: - rechts äusserst kräftig eingeschlagener Achterruf
(der Achterruf ist eine eher ungewöhnliche Kombination)
Der Einschlag ist deutlich länger, als die übrigen Achterrufnoten. Auch der Abschlag ist länger und betont (3)
- dann folgt ein rechter betonter und punktierter Schlep (4)
4. Takt: - er gestaltet sich gleich wie der 1. Takt. Elemente (1) und (2)
5. Takt: - wie der 2. Takt, aber der Schlep (4) am Schluss des Taktes fällt weg
Es wird sogleich zur Wiederholung eingeleitet. Alle vier Takte werden in der Folge wiederholt. Anschließend folgt der Takt
5. Takt: - ein Neunerruf ohne Schlepeinschlag, dafür zwei nicht betonte rechte Einschläge, betonter rechter Abschlag (5)
6. Takt: - rechts äusserst kräftig eingeschlagener Achterruf. Der Einschlag ist deutlich länger, als die übrigen Achterrufnoten
Auch der Abschlag ist länger und betont (genau wie 3)
- dann folgt ein betonter rechter, nicht punktierter Schlep (6)
7. Takt: - genau gleich wie der 5. Takt (5)
8. Takt: - wie 6. Takt (3), nur fällt der Schlep (6) weg
Sogleich wird zur Wiederholung eingeleitet und Takt 5-8 nochmals gespielt. Anschliessend wird zum Takt 1 zurückgekehrt und in der beschriebenen Reihenfolge wickelt sich der Narrentanz nun wiederum ab.
Wenn der Narrentanz abgeschlossen werden will, wird zu den eigenen, jedoch nicht genau festgelegten Abschlussnoten eingeleitet.